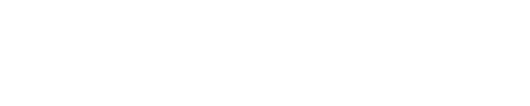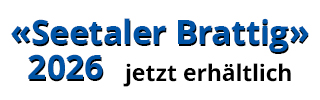*Erwin Koch, Hitzkirch, «Seetaler Brattig» 2023
Es war ein warmer Herbst, als acht Mitglieder der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB), ein Gleisarbeiter, zwei Schreiner, ein Kranführer, ein Mechaniker, ein Maurer, ein Mostereiarbeiter und – eigentlich untypisch – ein Primarlehrer, beschlossen, sich in Hitzkirch, damals knapp 1200 Einwohnerinnen und Einwohner, nach einem Stück Land umzusehen, um darauf acht kleine Häuser zu setzen, eines neben das andere, vier vorne, vier hinten, 1961.
Eine Wiese im Ortsteil Ferne, leicht abschüssig, kam infrage. Sie trafen sich mit dem Eigentümer Alois Meier, Landwirt und Briefträger, man war sich schnell einig: 13 Franken sollte der Quadratmeter kosten. Die acht Bauwilligen gründeten einen Verein, die Wohnbau-Aktion der KAB Hitzkirch. Der Primarlehrer wurde zum Präsidenten bestellt, der Gleisarbeiter zum Kassier, ein Schreiner zum Aktuar – und bereits im Dezember unterschrieben alle acht einen Kaufvertrag, jede Parzelle mass ungefähr 500 Quadratmeter, kostete rund 6500 Franken, fast den Jahreslohn eines Arbeiters.
Sie nahmen sich einen jungen Architekten aus Ermensee, Paul Zürcher, der seine Ausbildung eben erst abgeschlossen hatte und noch bei der Mutter wohnte, Mamas Stubentisch war sein Arbeitstisch – Zürcher entwarf ein Haus, kleine Küche, grosse Fenster, Pultdach statt Sattel, Betonlamellen gegen Süden.
Kanton erhebt Einspruch
Mitte März 1962 reichten die acht Arbeiter bei der Gemeinde Hitzkirch ihre Baugesuche ein und stellten, wie es Vorschrift war, acht Baugespanne auf die Wiese am Südrand des Ortes. Und im Dorf ging bald die Rede: Die haben, vom Lehrer wohl abgesehen, ja gar kein Geld. Womit bezahlen die ihre Häuser? Und die sind, vom Lehrer abgesehen, ja alle nicht hier geboren.
An einem Sonntag nach dem Hauptgottesdienst zog eine Handvoll besorgter Bürger, unter ihnen ein Seminarlehrer, mit Messbändern aus und massen, ob die Arbeiter die Abstände einhielten und nicht – Vertrauen ist gut, Kontrolle noch besser – vielleicht sogar beschissen.
Hitzkirch war damals noch der Ort der Obstverwertung und des Kantonalen Lehrerseminars – im Seminar, von sogenannten Professoren herangezogen, gedieh die Elite der Gesellschaft, junge Lehrer, die nach ihrer Diplomierung in die Dörfer ausströmten, dort unterrichteten und bei Bedarf den Kirchenchor leiteten. Das Lehrerseminar, seit 1868 in der ehemaligen Deutschritterkommende untergebracht, platzte aus allen Mauern, eine Erweiterung tat Not – und nun hatten Schreiner, Maurer, Mechaniker, Gleisarbeiter vor, ihre Häuschen ausgerechnet neben jene Wiese zu bauen, die für das neue Seminar infrage kam. Flugs erhob der Kanton, von den Professoren alarmiert, Einsprache gegen das Ansinnen der «Büezer».
Bitte um Bürgschaft
Am 16. April 1962, nachmittags um vier Uhr, lud der Hitzkircher Gemeinderat die Kontrahenten ins Restaurant Engel. Jede Partei sass zu fünft im Säli, Professoren hier, Arbeiter dort. Der Gemeindeammann eröffnete, übergab das Wort einem Vertreter des Kantonalen Baudepartements, dann dem Kantonalinspektor, der seiner Befürchtung Ausdruck verlieh, die Siedlung der KAB könnte mit Hühner- und Hasenställen sowie mit Gartenhäuschen überbaut werden, sodass der Eingang zum geplanten Seminar beträchtlich gestört werde. Zumindest auf die vier Häuser, die dem Seminar am nächsten kämen, sei zu verzichten, am besten auf alle acht.
Zwei Tage später schickte der Präsident der Wohnbau-Aktion der KAB Hitzkirch einen Brief nach Luzern, Empfänger war das kantonale Büro für Landerwerb – man verlange grundsätzlich und ohne weiteren Verzug die Baubewilligung für die geplante Siedlung. «Als erste Tatsache möchten wir festhalten, dass wir Besitzer Ihres nachbarlichen Grundstückes waren, bevor der Staat zum Kaufe des Gebietes für das künftige Lehrerseminar schritt (…) Eine Verlegung unserer Siedlung bringt uns derart innere und äussere Schwierigkeiten, dass die Weiterführung unserer Aktion in Vereinsform (gemeinsamer Einkauf, Mengenrabatte, Architektenhonorar etc.) überhaupt in Frage gestellt wird. (…) Der Bau eines Schulhauses verlangt (nach Aussage des Erziehungsdirektors des Kantons Luzern) für 400 Schüler ca. 6000 m2 Land. Es scheint uns deshalb einfach unglaubhaft, dass das neue Seminargebäude (für ca. 200 Seminaristen) auf dem 15‘000 m2 umfassenden Gelände nicht derart gestellt werden kann, dass es von unserer Siedlung nicht gestört wird.»
Einige der acht Bauwilligen, noch nicht dreissig Jahre alt, hatten ihr gesamtes Geld dazu verwendet, eine Parzelle zu kaufen. Die Banken, die sie um eine Hypothek angingen, lehnten ab – allenfalls, so der Bescheid, lasse man mit sich reden, wenn die Gemeinde den Arbeitern eine Bürgschaft gewähre.
Am 24. April 1962 übergaben sie der Gemeinde Hitzkirch einen Brief, versehen mit der Bitte, jeden Bauwilligen, so dieser es wünsche, mit dem Versprechen einer Bürgschaft von 10‘000 Franken abzusichern, denn ein Eigenheim «ist fast das einzige Mittel, mit dem auch der Arbeiter und Angestellte an der Konjunktur teilhaben und mit seiner Freizeit und ungenützten Arbeitskraft zu gewisser (übrigens auch versteuerbarer) Kapitalbildung gelangen kann».
«Wir waren zuerst da»
Am Sonntag, 13. Mai 1962, kurz nach der heiligen Messe, trafen sich die Hitzkircher Männer im neuen Schulhaus zur Gemeindeversammlung. Sie redeten kurz über die Verwaltungsrechnungen pro 1961, über Voranschläge und Steuern pro 1962, über einen Kredit zur Projektierung einer Turnhalle – zuletzt über das Gesuch der acht Arbeiter, nur fünf davon wohnten in Hitzkirch. Von 290 Stimmberechtigen sassen 85 in einem Zimmer. Der Präsident der Wohnbau-Aktion, Lehrer Bernhard Koch, lobte die Vorteile einer Arbeitersiedlung. Das Eigenheim, sagte er, wirke der stets stärker werdenden Vermassung des Volkes entgegen, das Eigenheim erziehe zur Übernahme eigenen Risikos und eigener Verantwortung, das eigene Häuschen binde an Dorf und Volk. Und weder jetzt noch später werde das Bürgschaftsgesuch die Gemeinde Hitzkirch finanziell belasten – obwohl es den Siedlern den Bau ihrer Häuser erleichtere.
Dr. phil. I Franz Dilger, Altphilologe, Priester und Direktor des kantonalen Lehrerseminars, ergriff das Wort. Mit den Ausführungen von Lehrer Koch könnte er sich einverstanden erklären, falls denn die Siedlung an anderer Stelle zustande käme, denn notwendigerweise tangiere dieses Vorhaben die Interessen des Seminars. Prof. Emil Achermann, Seminarlehrer für Geschichte, Deutsch und Methodik, schob nach, die Wohnbau-Aktion schränke wesentlich die Dispositionsmöglichkeiten der Architekten ein, die geplanten Häuser und die geplanten Seminarbauten harmonierten nicht miteinander. Prof. Paul Vogel, Seminarlehrer für Mathematik, warf ein, die Siedlung der Katholischen Arbeiterbewegung stehe nicht im Einklang mit der Ortsplanung und müsse deshalb abgelehnt werden.
Da hielt ein Schreiner nicht länger an sich, Toni Kupper, 29 Jahre alt, frisch verheiratet: «Wir haben unser Land gekauft, bevor der Kanton nebenan seines kaufte. Wir waren zuerst da. Wer nun dagegen ist, dass wir bauen, bedient sich nicht demokratischer Methoden, sondern der Methoden Chruschtschows.» Nikita Sergejewitsch Chruschtschow war damals Erster Sekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, stärkster Mann im Land, Schreckfigur des Westens.
Kurz vor Sonntagmittag schritten die Hitzkircher Männer zur Abstimmung. Fünf waren dafür, den Arbeitern, die dies wünschten, eine Bürgschaft zu leisten, achtzig dagegen – wer kein Geld hat, braucht kein Haus.
Die Unbeirrbaren setzen sich durch
Elf Tage später sass der Präsident der Wohnbau-Aktion im Büro von Regierungsrat Franz Xaver Leu, Vorsteher des kantonalen Baudepartements. Der Kanton, sagte der Magistrat, Sohn eines Schuhmachers, kaufe den Arbeitern ihr Land ab – für 20 Franken pro Quadratmeter, unter der Bedingung, dass sie ihre Häuser woanders bauten, vielleicht in Gelfingen.
Doch darauf gingen sie nicht ein, baten Verwandte und Bekannte um Geld, sprachen wieder und wieder bei Banken vor. Die Luzerner Kantonalbank schliesslich wertete die künftigen Arbeitsleistungen der acht Bauherren – isolieren, malen, täfern, Böden legen, Fenster anschlagen – als Eigenmittel und gewährte Hypotheken.
Am frühen Morgen des 23. Juni 1962, um Viertel vor sechs, lud der Hitzkircher Pfarrer die Arbeiter und ihre Frauen vor den Marienalter, er bat Gott den Allmächtigen um seinen Segen für die neue Siedlung in der Ferne – dann war Spatenstich am Saum des Dorfes. Im Lauf des Jahres 1963, einer nach dem andern, zogen die Unbeirrbaren in ihre Häuser, vier Jahre später begannen nebenan die Arbeiten für das neue, stolze Lehrerseminar – das längst nicht mehr ist.
*Erwin Koch (geboren 1956), war bis zu seiner Pensionierung Journalist und wohnte, bis er Hitzkirch verliess, ab seinem siebten Lebensjahr im Meierhöfliquartier, wo er nun seit 18 Jahren wieder lebt.