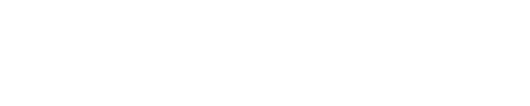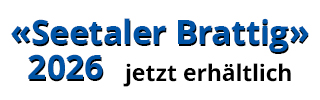*Erwin Muff, Willisau, «Seetaler Brattig» 2004
Die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Brot, Milch, Kartoffeln und damit das Verhüten von Hungersnöten war über Jahrhunderte hinweg eine der wichtigsten Aufgaben der jeweiligen Regierungen.
Von jenen Frauen und Männern, die heute 40 Jahr und älter sind, erinnern sich wohl die meisten an die btsache, dass Engerlinge und Maikäfer eine echte Plage waren und an Kulturen und Wäldern immensen Schaden anrichteten. Das ging so weit, dass manche Bauern fast an den Rand ihrer Existenz getrieben wurden. Ein Blick noch weiter in die Geschichte zurück zeigt, dass zum Beispiel im Jahre 1870 zwischen den Kantonen Zürich, Luzern, Schwyz, Zug, St. Gallen, Graubünden und Aargau ein Konkordat in Kraft gesetzt wurde, das gemeinsame Massnahmen zur Vertilgung der Maikäfer und Engerlinge zum Gegenstand hatte. Nur ein gemeinsames Vorgehen konnte nach Auffassung der damals Verantwortlichen dieser Landplage Einhalt gebieten und Hungersnöte vermeiden. Die Konkordatskantone hatten das Einsammeln der Maikäfer als obligatorisch zu erklären und unter die Kontrolle des Staates zu stellen. Das freiwillige Sammeln wurde durch Prämien gefördert. Als die Aargauer in den Grenzgebieten Mühlau, Sins und Oberrüti dieser Vorschrift nur mangelhaft nachkamen, handelten sie sich eine offizielle Rüge der Zuger Regierung ein.
Persönliche Erinnerungen
Damals im Sekundarschulalter stehend, erinnere ich mich an viele Einzelheiten des Schadenjahres 1949, das zudem von einer katastrophalen Trockenheit begleitet war. Zahlreiche private und öffentliche Wasserversorgungen versagten ihren Dienst. Das kostbare Gut musste für Mensch und Tier kannenweise zugeführt werden. Zusätzlich zu diesen Dürreerscheinungen gesellten sich die Schäden der gefrässigen Engerlinge. Die Bauern mussten die Viehbestände drastisch reduzieren, nicht zuletzt mit Blick auf den kommenden Winter mit leer gebliebenen Heubühnen.
Noch heute zieht es mich jedes Jahr einige Male auf die Höhen des Lindenbergs zum Sulzer Kreuz. Nicht nur um die prächtige Aussicht mit Blick auf die Seen und den imposanten Alpenkranz zu geniessen, sondern auch an diesem ruhigen und beschaulichen Ort mich meiner Jugend und meiner Herkunft zu erinnern. Dabei wird mir jeweils bewusst, wie sehr mich Elternhaus, Schule und Umgebung geprägt haben. Und seit einiger Zeit habe ich Verständnis dafür, wenn sich unser lieber Papa fürchterlich aufregte, wenn wir uns beklagten, an einem so langweiligen Ort aufwachsen zu müssen…
Auf dem Weg zum besagten Ort kommt mir beim Passieren des Wasserreservoirs von Sulz nicht nur die Wasserknappheit in den Sinn, die damals den Ausfall der Wasserversorgung zur Folge hatte, sondern unweigerlich auch die unmittelbar daneben gelegene, von uns bewirtschaftete Parzelle Widacher. Diese war im besagten Trocken- und Engerlingsjahr 1949 mit ungefähr zwei Jucharten Kartoffeln bepflanzt: Böhms – allerfrühste – gelbe und Ackersegen, wenn ich mich recht erinnere.
Die Parzelle war offenbar ein ideales Anfluggebiet für Maikäfer vom nahe gelegenen Dünkelbachtobel, durchsetzt mit mächtigen Eichen und Buchen, die im Jahr zuvor allesamt von den Maikäfern kahlgefressen worden waren. Männchen und Weibchen sind in dieser Zeit nicht nur gefrässig, sondern auch liebesbedürftig. Nach erfolgter Paarung fliegen die begatteten Maikäferweibchen wieder auf die Felder zurück, um dort die Eier zu legen und dann zu sterben. Aus den Eiern entstehen die Engerlinge, die in der Regel bedeutend grösseren Schaden anrichten als die Käfer.
Wohlwissend, dass nicht mehr viel zu holen war, ordnete der Vater die Kartoffelernte an, schliesslich hatten sich ja kurz zuvor verschiedene Nachbarn als grosse moderne Errungenschaft gemeinsam einen neuen Kartoffelgraber angeschafft. Karrer Franz Lang fuhr mit dem treuen Pferdegespann Flory und Schimmel (Vaters Eidgenoss) Fohre um Fohre aus. Zusammen mit dem Italiener Luigi und anderen Angestellten sammelten wir die spärlichen, meist angefressenen Knollen. Resultat: Die ganze Ernte entsprach nicht einmal mehr der Saatgutmenge! Nicht besser war die Situation im Wiesland, wo wir nicht selten über 100 Engerlinge pro Quadratmeter zählten. Dies allerdings zur Freude der Hühner und Krähen.
Das geschilderte Erlebnis war kein Einzel-, sondern Normalfall und beschäftigte nicht nur die Bauern, sondern auch die ganze Öffentlichkeit. Gemeinden und Kantone kamen in Zugzwang und bereiteten Aktionen vor. Damals ahnte ich allerdings nicht, dass ich rund anderthalb Jahrzehnte später im Luzerner Hinterland und Wiggerertal als junger Agronom Leiter einer solchen Aktion werden sollte.
1966: Die wohl letzte grosse Bekämpfungsaktion dieser Art
Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Obst-. Wein- und Gartenbau in Wädenswil hatte eine eigene Zentrale für Maikäferbekämpfung (ZMB) eingerichtet und die Kantone wissenschaftlich beraten. Die Resultate der Engerlingsgrabungen in den Jahren 1964 und 1965 liessen für 1966 eine Maikäferinvasion von grossem Ausmass erwarten. Zahlreiche Kantone, wie Zürich, Graubünden, Thurgau, Baselland, Solothurn und Luzern waren der Auffassung, mit dem traditionellen Einsammeln von Käfern der Situation nicht mehr gewachsen zu sein. Sie planten Spritzaktionen mit Einsatz von Helikoptern. Die Zentralstelle für Ackerbau unter der Leitung von Peter Knüsel, damals beim Staatswirtschaftsdepartement des Kantons Luzern (Leitung Regierungsrat Adolf Käch) angegliedert, schuf drei Aktionsgebiete. Mit der jeweiligen Leitung wurden Lehrer an den Landwirschaftlichen Schulen von Willisau und Sursee beauftragt: Hans Brunner für das Seetal, Karl Hunkeler für das Surental und der Schreibende für das Gebiet Hinterland Wiggertal.
Dem Schlussbericht über die Aktion Seetal sind einige interessante Details zu entnehmen, die es verdienen, zuhanden der Nachwelt festgehalten zu werden. Auf Grund der Engerlingsgrabungen, die im Jahre 1964 von der Kantonalen Ackerbaustelle veranlasst wurden, entschlossen sich die Gemeinden Aesch, Altwis, Gelfingen, Lieli, Mosen, Schwarzenbach, Herlisberg und nachträglich Sulz, 1966 eine chemische Maikäferbekämpfungsaktion durchzuführen. Um die Anwendung von Insektiziden auf ein Minimum zu beschränken, wurde von einer Totalbehandlung abgesehen. Die Behandlung der Wälder erfolgte vom Helikopter aus. Die Haupteinsatztage waren der 4. und 5. Mai 1966. Schäden an Haustieren und Fischen waren, von einer Ausnahme abgesehen, keine aufgetreten. Die Kosten beliefen sich auf Fr. 5.45 pro ha landwirtschaftliche Kulturfläche. Kanton und Gemeinden übernahmen 25% der Gesamtkosten.
Solche Bekämpfungsaktionen wurden in den genannten Kantonen durchgeführt und als erfolgreich bezeichnet. Ob es den damals getroffenen Massnahmen zuzuschreiben ist oder ob veränderte biologische Bedingungen dafür verantwortlich sind, bleibt eine offene Frage. Nach Auffassung der Fachleute sind aber die Maikäfer immer für Überraschungen gut und ein neues massenhaftes Auftreten ist nicht auszuschliessen. Sicher ist aber, dass heute andere, vor allem biologische Bekämpfungsmassnahmen im Vordergrund stünden, wie der Einsatz des an der Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Zürich-Reckenholz entwickelte Pilz Beauveria. Dieser attakiert die Engerlinge und überwuchert sie. Der Forschung verdanken wir diese ökologisch unbedenkliche und biologische Schädlingsbekämpfung.
*Erwin Muff-Pfenninger (1935–2019) wurde in Sulz geboren, wo er auch aufwuchs. Nach seinem Studium an der ETH Zürich wurde er 1961 dipl. Ing.-Agr. ETH. Landwirtschaftslehrer und Betriebsberater an der Landwirtschafts- und Bäuerinnenschule Willisau. 1967 bis 1971 sass er für die Liberale Partei (heute FDP) im Luzerner Grosssen Rat. 1968 bis 1981 war er Stadtammann von Willisau, 1971 bis 1981 Nationalrat. Im Jahr 1982 wurde er in den Luzerner Regierungsrat gewählt. Dieses Amt führte er als Volkswirtschaftsdirektor bis 1995 aus. Auch danach blieb Erwin Muff-Pfenniger stark engagiert im Kanton Luzern, etwa als Präsident der Auto AG Holding Rothenburg (1995 bis 2005) oder als Präsident der Centralschweizerischen Kraftwerke Luzern (1997-2002).